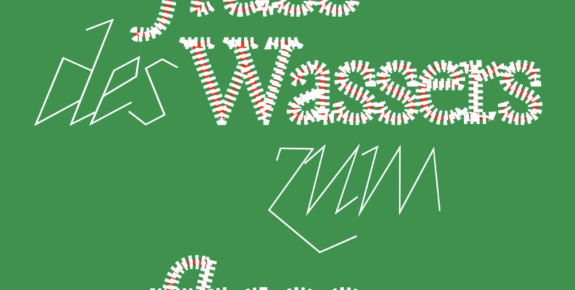Kein fliessendes Wasser, dreckige Luft, verseuchte Böden: Glencore nimmt Stellung zu Vorwürfen der kongolesischen Anwältin Nathalie Kangaji.
Ein Artikel von 20 Minuten (12.3.2019)

Auf der Suche nach Kupfer und Kobalt, die etwa für Smartphone-Akkus genutzt werden, sei dem Rohstoffunternehmen Glencore jedes Mittel recht. Im Bild: Das Schmelzwerk der Glencore-Mine KCC.
Nathalie Kangaji hat eine Mission: Die Anwältin aus dem Kongo will den Schweizer Rohstoffgiganten Glencore in die Schranken weisen. Glencore würde ohne Rücksicht auf die Bevölkerung und die Natur zwei der ergiebigsten Kupferminen kontrollieren, die grösser seien als der ganze Kanton Basel-Stadt, behauptet die 48-Jährige, die in betroffenen Slumgebieten arbeitet. Auf der Suche nach Kupfer und Kobalt (siehe Box), die etwa für Smartphone-Akkus genutzt werden, sei dem Rohstoffunternehmen jedes Mittel recht.
Box: Kobalt
- Kobalt ist omnipräsent: In jedem Smartphone-Akku befinden sich zehn Gramm davon, in jedem Elektroauto rund acht Kilo.
- Die steigende Nachfrage liess den Preis vorübergehend innerhalb eines Jahres von 33'000 auf 95'000 US-Dollar pro Tonne im März 2018 ansteigen.
- Zwei Drittel der globalen Kobaltproduktion stammen aus dem Kongo
- Die in Zug beheimatete Rohstoff-Firma Glencore kontrolliert im Kongo zwei der ergiebigsten Minen: Die Kamato Copper Company (KCC) und die Tagebaumine Mutanda Mining (Mumi). Beide Minen zusammen sind grösser als der ganze Kanton Basel-Stadt. Als Nebenprodukt des Kupferbergbaus holt Glencore ein ungleich wertvolleres Metall aus dem Boden: Kobalt.
«Kaum jemand denkt beim Kauf des neuesten iPhones daran, unter welchen Bedingungen die Rohstoffe gefördert werden. Niemand denkt an uns», sagt Kangaji, deren Organisation CAJJ von den Schweizer NGOs Brot für alle und Fastenopfer unterstützt wird. Sie hofft, dass die Konzernverantwortungsinitiative (siehe Box) in der Schweiz angenommen wird.
20 Minuten hat Glencore mit den Vorwürfen der Anwältin Kangaji konfrontiert.

Auf dem Bild rechts: Die kongolesischen Anwältin Nathalie Kangaji
Fehlende Infrastruktur
«Zahlreiche Anwohner der Dörfer rund um die Glencore-Minen haben weder Zugang zu fliessendem Wasser noch Strom», sagt Kangaji. Die Gesundheitsversorgung sei miserabel und Ausbildungsstätten für Jugendliche oder junge Erwachsene gebe es nicht. «Glencore hat aber schon vor Jahren versprochen, etwa Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Doch passiert ist nie etwas.»
Das sagt Glencore:
Glencore-Sprecherin Sarah Antenore betont, dass Glencore 407 Millionen Franken Steuern und Abgaben allein im Jahr 2017 an die Regierung Kongos gezahlt hat – darunter auch für Infrastrukturprojekte. «Wir dürfen und können nicht die Rolle des Staates übernehmen», sagt Antenore. «Mit über 22’000 Angestellten in der Region nehmen wir aber auch unsere Verantwortung als grösster Arbeitgeber in der Gegend wahr.»
So habe man mit der Regierung Kongos ein Projekt zur Modernisierung der Strominfrastruktur im Umfang von 400 Millionen Franken lanciert. Zudem habe man in nationale Ausbildungsprogramme investiert und die Reparatur von Schulgebäuden und Krankenstationen finanziert. Antenore: «Wir haben 15 neue Brunnen gebaut, bestehende saniert und arbeiten an weiteren Lösungen, um die Trinkwassersituation in den anliegenden Gemeinden zu verbessern.»
Verschmutzung der Luft
«Die Anwohner leben in einer Welt, in der es schädlich ist, zu atmen», sagt Kangaji. «Schuld daran ist die Staubentwicklung, die durch die zahlreichen Transport-Lastwagen von Glencore verursacht werden.» Kangaji fordert Glencore daher auf, die Zufahrtsstrassen der Minen zu asphaltieren. Aber auch von den Abraumhalden der Minen wehe der Staub in die Dörfer. Husten und Bronchitis seien die Folge. Kangaji: «In Musonoi wurden Grobpartikel-Werte zwischen 150 und 275 gemessen. Der Grenzwert der WHO liegt bei 50.»
Das sagt Glencore:
Die Aussage, dass sich Glencore «weigere», die Strassen zu asphaltieren sei falsch. «Glencore zahlt speziell für diesen Zweck vorgesehene Strassen-Steuern an die Regierung. Wir unterstützen die Regierung zudem beim Bau einer Ringstrasse, um die Stadt und umliegende Gemeinden vom Schwerverkehr zu entlasten», sagt Glencore-Sprecherin Antenore. Ausserdem würden die Strassen auch von anderen Bergbauunternehmen und Anwohnern benutzt.
«Glencore ergreift vor Ort Massnahmen zur Reduzierung der Staubbelastung.» So setze das Unternehmen beispielsweise Bewässerungssysteme und bestimmte Produkte zur Staubreduktion ein und sorge für die Instandhaltung der Strassen. «Unsere Tochterfirma KCC hat zudem eine Reihe von Bäumen vor der Musonoi-Gemeinde gepflanzt, um die Einwohner vor dem Staub zu schützen», sagt Antenore.
Wasserverschmutzung
«Die Glencore-Mine KCC hat mit Säure und Schwermetallen versetztes Abwasser bis 2014 direkt in den Fluss Luilu geleitet», sagt Kangaji. «Die Situation hat sich in letzter Zeit gebessert, aber der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist in den Quartieren rund um die Mine immer noch ein grosses Problem. Die lokalen Ärzte müssen aufgrund des verschmutzten Wassers viele Patienten mit Durchfall oder Hepatitis behandeln.»
Das sagt Glencore:
Antenore: «Wir haben erhebliche Investitionen getätigt, um die Probleme mit Wasseraltlasten in der Verarbeitungsanlage anzugehen.» Denn frühere Betreiber hätten die über 50 Jahre alte Anlage schlecht gewartet und Abwasser unbehandelt in den Fluss Luilu eingeleitet.
Glencore habe Millionen investiert, Dutzende Kilometer Rohrleitungsinfrastruktur verlegt und Spezialpumpen und Kläranlagen gebaut, um sämtliches Abwasser vor der Einleitung in den Wasserkreislauf zu säubern. Die Wasserqualität werde täglich kontrolliert, Regierungsinspektoren würden regelmässig Stichproben durchführen. Ausserdem sei Glencore nicht
das einzige Unternehmen, das Wasser in den Luilu einleite, erklärt Antenore weiter.

Verseuchte Böden
Die Minentätigkeit von Glencore habe die Böden in der Umgebung vergiftet, sagt Kangaji. So etwa in Moloka im September 2014: «Während über einem Jahr flossen Schadstoffe aus der Glencore-Mine Mumi auf die Felder von 26 Bauernfamilien.» Ausser einigen Bäumchen, die Mumi als Wiedergutmachung habe pflanzen lassen, wachse dort nichts mehr. «Aber auch die gedeihen auf dem vergifteten Boden nicht richtig.»
Erst durch das Einschreiten des CAJJ und nach zahllosen Diskussionen habe Glencore den Fehler der Tochtergesellschaft Mumi schlussendlich anerkannt und sich bereit erklärt, Kompensation zu leisten. 65’330 US-Dollar hätten sie den 26 Familien insgesamt bezahlt. «Keine Kompensation erhielten die Familien jedoch für den Boden, der jetzt nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar ist», so Kangaji.
Das sagt Glencore:
Antenore bestätigt, dass es damals zu einem ungeplanten Austritt von Kobalt gekommen war, der die benachbarten Felder beschädigte. Die Glencore-Mine Mutanda Mining habe daraufhin gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern, dem Departement für den Schutz der Bergbauumgebung und CAJJ ein Kompensationssystem vereinbart.
«Damals verlangte keiner der Teilnehmenden eine Entschädigung für das Land», sagt Antenore. Erst nach Abschluss der Entschädigungsvereinbarung habe CAJJ Ersatzgrundstücke für die betroffenen Grundeigentümer verlangt und einen entsprechenden Antrag an das örtliche Büro des Landwirtschaftsministeriums übermittelt. «Bis heute hat Mumi keine weiteren Informationen zu diesem Thema erhalten.»
Darum gehts
Am Dienstag debattiert der Ständerat über die Konzernverantwortungsinitiative (Kovi). Die Initiative verlangt, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz für ihre ausländischen Tochtergesellschaften und für ökonomisch kontrollierte Geschäftspartner haften, wenn sie gegen die Menschenrechte verstossen oder die Umwelt schädigen. Ausser die Firma kann beweisen, dass sie ihren Sorgfaltspflichten nachgekommen ist.
Gegenvorschlag I des Nationalrates: Die Konzernhaftung erfasst nur einen beschränkten Kreis von grossen Unternehmen. Zudem beschränkt sich die Haftung nur auf effektiv kontrollierte Tochtergesellschaften und auf Verletzung von Leib und Leben oder Eigentum.
Gegenvorschlag II der Rechtskommission des Ständerates: Bei diesem Vorschlag sollen Kläger – soweit zumutbar – im Ausland gegen die Tochtergesellschaft vorgehen und erst nach einer gewissen Frist an Schweizer Gerichte gelangen dürfen.