Wie Konzerne wie Syngenta Afrika "entwickeln", um sich Land, Saatgut und Profite anzueignen.
„Glauben Sie wirklich, dass Afrikas Ernährungssicherheit und -souveränität durch internationale Kooperation gesichert werden kann ausserhalb all der Regelwerke, die zusammen mit den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, den Produzentinnen und Produzenten des Kontinents formuliert wurden?“
Mit dieser Frage wendet sich Mamadou Cissokho, der Ehrenpräsident eines Netzwerks der fünfzehn grössten westafrikanischen Bäuerinnen- und Bauernorganisationen (ROPPA), an den Präsidenten der Afrikanischen Union und alle afrikanischen Staatsoberhäupter (siehe Letter from African Civil Society Critical of Foreign Investment in African Agriculture at G8 Summit, 23.5.2012). In diesem offenen Brief kritisiert er Allianzen mit wohlklingenden Namen wie „G8 New Alliance for Food Security and Nutrition“, „Grow Africa“ oder „Alliance for a Green Revolution in Africa“, deren erklärtes Ziel es ist, Afrikas Landwirtschaft zu ‚entwickeln’. Diese Allianzen entstanden auf Initiative der Länder der G8 oder der Bill and Melinda Gates Foundation und bestehen aus der Polit- und Wirtschaftselite der Industrieländer und derjenigen der beteiligten Länder Afrikas. Obwohl Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den Entwicklungsprogrammen dieser Allianzen immer als zentrale Akteurinnen und Akteure dargestellt werden, kommen sie bei genauerer Betrachtung vor allem als Ausführende vor. Mitzureden, Ziele zu entwickeln oder gar über den Einsatz finanzieller Mittel und die Formulierung relevanter Gesetzesvorlagen zu entscheiden, wird ihnen selten zugestanden. Vielmehr sind sich die vereinigten Eliten einig, dass sie es sind, die Afrikas Landwirtschaft entwickeln müssen.

Mamadou Cissokho, der Ehrenpräsident eines Netzwerks der fünfzehn grössten westafrikanischen Bäuerinnen- und Bauernorganisationen (ROPPA)
Da bleiben für die meisten Kleinbäuerinnen und -bauern kaum Alternativen. Bleiben die Bauernbetriebe bestehen, werden sie abhängig von den unberechenbaren Weltmärkten oder von grossen Konzernen. Wird ihnen das Land (oft gegen ihren Willen) abgekauft, arbeiten sie nachher als Lohnabhängige auf Plantagen zu meist sehr niedrigen Löhnen. Sie sind daher auf eine Politik ihrer Regierung angewiesen, welche die Anliegen der zahlreichen Kleinbäuerinnen und -bauern einbezieht, sie unterstützt und die regionale Ernährungssouveränität ermöglicht.
Für die Allianzen der Eliten aber heisst ‚Entwicklung’ vor allem die Anbindung der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern an internationale Märkte, Produktionsketten und globale Unternehmensnetzwerke. Sollte ihnen dies gelingen, gäbe es in Afrika viel Geld zu verdienen – und dies vor allem für die Konzerne, die Teil dieser Allianzen sind. Die Weltbank selber schreibt, in Afrika seien die Erfolgsaussichten für Landwirtschaft und Agrobusiness besser als je zuvor (siehe Weltbank, 11.3.2013). Darum sind in diesen Allianzen all die Grossen des Agrobusiness gut vertreten – und Syngenta ist vorne mit dabei.
Syngentas Pläne: Die Stufen des ‚Fortschritts’
Syngenta hat grosse Pläne in Afrika, denn die Landwirtschaft Afrikas sei „zu wichtig, um sie dem Zufall zu überlassen“ (siehe Syngenta, 18.3.2013). Zufall steht hier wohl für die Menschen, die in Afrika leben und arbeiten. 2012 erklärte der damalige Syngenta-CEO Michael Mack Afrika zu einer strategischen Wachstumsregion und versprach, zur Transformation der afrikanischen Landwirtschaft beizutragen (siehe Syngenta, 18.5.2012).
Die Pläne klingen ziemlich grossspurig: Syngenta will 700 Landwirtschaftsexpertinnen und -experten einstellen, fünf Millionen Bäuerinnen und Bauern mit ihren Produkten erreichen, eine halbe Milliarde US-Dollar (USD) in ihr Afrikageschäft investieren und bis 2022 dessen Jahresumsatz auf eine Milliarde USD steigern (siehe Syngenta Jahresbericht 2014). Verglichen mit dem weltweiten Umsatz von 15,1 Milliarden USD im Jahre 2014 ist dies immer noch wenig. Dies liegt an den aus Sicht der Konzerne wenig ‚investitionsfreundlichen’ Rahmenbedingungen, mit anderen Worten, an gesetzlichen Rahmenbedingungen wie Sortenschutzgesetzen und mangelnder Infrastruktur für den Vertrieb ihrer Produkte.
Syngenta ist ausserordentlich aktiv, um diese Rahmenbedingungen in ihrem Sinne umzugestalten und den Weg zu den afrikanischen Märkten zu ebnen. Neben ihrem Engagement in den erwähnten Allianzen hat Syngenta dafür auch ihre eigene Stiftung. Diese “Syngenta Stiftung für Nachhaltige Landwirtschaft” (SSNL) nennt als Hauptproblem, dass in Afrika südlich der Sahara fast dreissig Millionen Hektaren Land von über hundert Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bewirtschaftet werden und dass nur auf einem Zehntel dieser Fläche Zugang zu sogenannten Qualitätsinputs – also Saatgut und Pestiziden von Syngenta – besteht. Die Stiftung will diese ‚prä-kommerziellen’ Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dabei unterstützen, ‚professionelle’ Landwirtinnen und Landwirte zu werden (siehe Website von Syngenta Foundation).
Die Syngenta-Stiftung und viele weitere Stiftungen sowie die oben beschriebenen Allianzen unterstützen ein ganz spezifisches Landwirtschaftsmodell. Es fusst auf der Idee, dass sich ‚traditionelle’ Gesellschaften ‚modernisieren’ müssen. In einer ihrer Publikationen (siehe Syngenta Foundation, 4.2010) beschreibt die Stiftung, wie sich der Konzern die landwirtschaftliche ‚Entwicklung’ vorstellt. Am Anfang steht die Subsistenzwirtschaft („subsistence smallholders“), die sich zuerst zu halbkommerziellen (“semi-commercial“) und dann zu kommerziellen („commercial“) Kleinbäuerinnen und -bauern entwickeln sollen. Das Ziel schliesslich sind ‚fortschrittliche’ Bäuerinnen und Bauern („advanced farmers“). Unter ‚fortschrittlich’ versteht Syngenta sogenannte integrierte Landwirtschaftsmodelle mit Hybrid- und Gentechsaatgut, Pflanzenschutzmitteln und Dünger der Konzerne. Kleinbäuerinnen und -bauern sollen entweder ‚fortschrittlich’ („advanced“) werden – oder in die Städte migrieren („migration out of agriculture“). Es geht vor allem darum, Bäuerinnen und Bauern zu schaffen, welche Syngentas Produkte verwenden und das Geld haben, diese zu kaufen. Nur dies verspricht Profit für die Firma (siehe Syngenta Foundation, 4.2010).
An diesem Entwicklungsmodell des Agrobusiness gibt es zwei wichtige Kritikpunkte. Die erste Kritik ist, dass die industrielle Landwirtschaft auf dem Einsatz von fossilen Rohstoffen und Agrochemie fusst, gravierende Umweltprobleme verursacht und stark zum Klimawandel beiträgt. Laut der NGO Grain, stammen fast die Hälfte der Treibhausgase direkt oder indirekt aus der Landwirtschaft (siehe GRAIN 2013). Der zweite zentrale Kritikpunkt ist der alleinige Fokus auf Produktionssteigerungen zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung. Tatsache ist jedoch, dass genug Essen produziert wird, um etwa 50 Prozent mehr Menschen auf diesem Planeten zu ernähren. Gleichzeitig hat jedoch einer von neun Menschen momentan nicht genug zu essen (siehe FAO, 2015). Der Grund liegt darin, dass sich viele Menschen wegen ihrer Armut kein Essen kaufen können. Die Steigerung der Produktion allein wird also den Hunger nicht beseitigen – und schon gar nicht, wenn die Produktionssteigerung auf privaten Investitionen beruht. Denn diese stärken jene Mechanismen, welche dafür sorgen, dass produziert wird, was Profit bringt, und nicht, was den Hunger stillt. Es muss zwingend über Verteilungsgerechtigkeit geredet werden: Wer hat die Möglichkeit zu entscheiden, was, wie und für wen produziert wird sowie darüber, wem das Land und die Ressourcen gehören sollen. Aber davon ist in den Visionen der Allianzen und der erwähnten Stiftungen nie die Rede.
Public Private Partnerships: die Macht der Privatwirtschaft entfesseln
Die „G8 New Alliance for Food Security and Nutrition“ (kurz: New Alliance) und „Grow Africa“ arbeiten mit aller Kraft auf die Transformation der Landwirtschaft in Afrika hin. Sie sind Public Private Partnerships (PPPs) und haben zum Ziel, die Investitionen in den Agrarsektor zu erhöhen. PPPs sind eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen der Privatwirtschaft. Die grossen Agrarkonzerne sind in dieser Zusammenarbeit für die effiziente Einbindung der gewinnversprechenden Bereiche der afrikanischen Landwirtschaft in die globalen Kreisläufe der Kapitalakkumulation zuständig.
Mit von der Partie bei der New Alliance sind Agrochemiekonzerne wie Syngenta, Monsanto und Yara (der weltweit grösste Düngerhersteller aus Norwegen) und die Nahrungsmittelriesen Nestlé und Danone, aber auch global tätige Handelsunternehmen wie Cargill und Louis Dreyfus Commodities sowie die Rückversicherung Swiss Re und die Standard Bank. Die Durchsetzung der dazu benötigten Rahmenbedingungen erledigen die Regierungen. Für hohe, aber unverbindliche Investitionsversprechen bieten sie Steuererleichterungen und Änderungen ihrer Gesetze oder beispielsweise auch private Zugangsrechte zu Land- und Wasserressourcen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht hat gezeigt, dass dies zu Land Grabbing führen kann: Oft werden grosse Flächen von Land ohne Mitsprache der Bäuerinnen und Bauern ausländischen Investorinnen und Investoren zur Verfügung gestellt (siehe Actionaid, 3.6.2015).
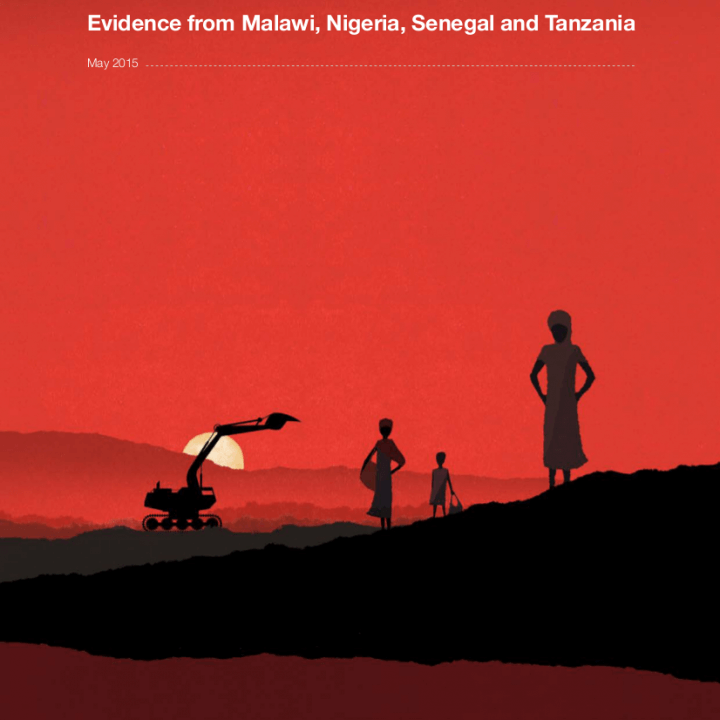
Studie von Actionaid zu den Folgen der New Alliance for Food Security and Nutrition
Bei den Änderungen ihrer Gesetze werden die afrikanischen Länder von internationalen Institutionen wie der Weltbank unterstützt. Oft sind auch die grossen Entwicklungsbüros der reichen Industrieländer dabei. Bei Grow Africa zum Beispiel ist die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zusammen mit USAID Hauptgeldgeberin. Dank dieser Kombination sollen vor allem private Investitionen fliessen. Regierungen hingegen werden damit aus ihrer Verantwortung entlassen, öffentliche Gelder für die Entwicklung der Landwirtschaft und damit für die Umsetzung des Menschenrechts auf Nahrung einzusetzen.
Wachstumskorridore
Ein gutes Beispiel, um diese PPPs zu verstehen, sind die sogenannten Wachstumskorridore. Syngenta ist besonders im „Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania” (Sagcot) involviert. Im Rahmen von Wachstumskorridoren soll in einem zusammenhängenden Gebiet die gesamte landwirtschaftliche Wertschöpfungskette entwickelt werden. Der Sagcot-Korridor umfasst einen Drittel des tansanischen Festlands sowie die nördlichen Teile von Malawi und Sambia. Die Regierungen passen dafür Sortenschutzgesetze an und erleichtern den involvierten Konzernen Zugang zu Land und zu anderen Ressourcen. Als Gegenleistung investieren die Konzerne in Landwirtschaft und Infrastruktur einer Region, welche typischerweise bereits einen Hafen, gute Transportmöglichkeiten und genügend fruchtbares Land besitzt. Es wird modellmässig in industrielle Landwirtschaft und vorwiegend in Exportproduktion investiert. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern werden oft durch Verträge (Contract Farming) an die zentralen Grossbetriebe angebunden. Dort können sie Dünger, Pestizide und Saatgut beziehen und ihre Ernte verkaufen.
Contract Farming könnte, wenn die Vertragsbedingungen fair sind, durchaus zu mehr Preissicherheit für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern führen. Doch gerade bei Sagcot sind die Verträge so abgefasst, dass die Bäuerinnen und Bauern bald Schuldenberge anhäufen – trotz zum Teil grösserer Erträge. Viele Berichte von Bäuerinnen und Bauern gleichen sich und handeln von negativen Erfahrungen mit der Abhängigkeit im Rahmen vom Contract Farming. Kilombero Plantations Ltd (KPL) ist eine Partnerin von Syngenta und lässt im Sagcot-Gebiet Reis im Contract-Farming-System anbauen. Einer der Bauern, die für KPL produzieren, spricht für viele: „Durch diesen Vertrag wurden wir gezwungen, Technologien zu akzeptieren, die wir für eine gute Ernte nicht wirklich brauchten. Alle Entscheidungen über den Anbau wurden von KPL gemacht: ‚Mach das!’, ‚Mach das so!’. Weil ich Schulden hatte, musste ich machen, was sie verlangten. Ich fühlte mich nicht frei. Man hat einen eigenen Bauernhof und alles, aber wirklich alles wird von jemand anderem diktiert. Darum habe ich mir geschworen, nie wieder mit KPL Geschäfte zu machen.“ Eine Alternative zu finden, ist aber oft schwierig, denn die Firmen haben in diesen Regionen meist Monopolstellungen für den Verkauf von Dünger, Pestiziden und Saatgut sowie für den Ankauf der Ernte (siehe The Oakland Institute, 2015).

Machtungleichgewichte bestehen jedoch nicht nur zwischen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und ihren Handelspartnerinnen und -partnern. Bei grossen PPPs gibt es auch ein riesiges Machtgefälle zwischen den multinationalen Grosskonzernen einerseits und den Staaten und lokalen, kleineren Firmen andererseits. Der Markteintritt der grossen Agrarkonzerne kann zum Beispiel sehr wohl den Zugang zu Dünger oder Saatgut für einige Bäuerinnen und Bauern erleichtern. Aber er birgt auch das Risiko, dass Monopole in diesen Bereichen geschaffen und lokale Firmen verdrängt werden. Zitto Kabwe, der Vorsitzende des Komitees für öffentliche Ausgaben des tansanischen Parlaments, sagte, dass er entschieden gegen die Bemühungen seiner Regierung sei, private Investitionen in Saatgut zu fördern. Er ist sich sicher, dass dies „die Innovation auf der lokalen Ebene abwürgt. Wir haben das schon in der verarbeitenden Industrie gesehen“ (siehe The Guardian, 18.2.2014).
Sobald sich die Agrokonzerne etabliert haben, verlieren die Regierungen immer mehr Einfluss. Bei Sagcot zum Beispiel beträgt der kombinierte Jahresumsatz der involvierten Agrokonzerne (Syngenta, Bayer, Monsanto, Yara und United Phosphorus) fast 100 Milliarden Dollar – dreimal so viel wie das BIP der tansanischen Wirtschaft (siehe Oxfam, 1.9.2014). Bei solchen Machtungleichgewichten bräuchte es unbedingt Mechanismen und Institutionen, um die Rechte der lokalen Bevölkerung zu schützen. Mamadou Cissokho von ROPPA sagt dazu: „Wir glauben den multinationalen Unternehmen kein Wort, wenn sie uns versprechen, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Wer wird diese Verantwortung kontrollieren? (…) Welche ernsthaften und verlässlichen Klagemöglichkeiten können wir den Bäuerinnen und Bauern im Falle einer Verletzung unserer Rechte anbieten?“ (siehe tni, 27.5.2014).
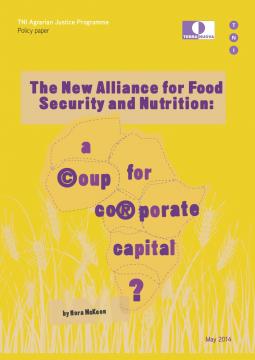
Report des Transnational Institute untersucht, wie multinationale Konzerne Entwicklungspolitik Afrikas beeinflussen
Landwirtschaftliche Entwicklung für Konzerne
Solche Public Private Partnerships und die damit zusammenhängenden Entwicklungsprogramme sind sehr gefährlich, denn die konzernbestimmte landwirtschaftliche ‚Entwicklung’ wird gleichsam unhinterfragte Normalität. Es erscheint plötzlich vernünftig, dass Syngenta, die ihr Geld mit dem Verkauf von chemischen Pflanzenschutzmitteln verdient, eine ,nachhaltige Landwirtschaft’ fördern will, obwohl der Konzern auf eine chemieintensive Landwirtschaft angewiesen ist. Diese Allianzen legitimieren die Interessen globaler Konzerne. Grow Africa und auch die New Alliance erlauben ihnen nach eigenen Aussagen, unter dem Deckmantel einer lokalen und von Staaten angeführten Initiative zu operieren (siehe tni, 27.5.2014). Es wird der Eindruck erweckt, es sei dasselbe, ob Konzerne in den Agrarsektor investierten oder ob Regierungen versuchten, für die in der Landwirtschaft tätigen, armen oder sogar Hunger leidenden Menschen Verbesserungen zu erreichen. Aber die grossen Agrobusinesskonzerne werden kaum im Sinne der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern entscheiden. Mit ihrer Politik verhindern sie vielmehr, dass die Regierungen ihren Fokus auf das Recht auf Nahrung legen können. Dazu kommt, dass nicht diejenigen Länder bei der New Alliance dabei sein dürfen, in denen Armut und Unterernährung besonders weit verbreitet sind, sondern die Länder, denen ein hohes wirtschaftliches Wachstumspotenzial vorhergesagt wird, wie beispielsweise Tansania.
Die afrikanischen Regierungen sind auch Teil dieser Allianzen. Zur New Alliance gehören neben der Afrikanischen Union zehn einzelne Regierungen. Dass die staatlichen Autoritäten beigezogen wurden, war ein wichtiger Schritt zur Legitimierung der Allianzen. Eine demokratische Entwicklung der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik ist damit jedoch noch nicht gegeben. Dafür braucht es zwingend den Einbezug von Organisationen, die die Interessen der betroffenen Menschen vertreten: Organisationen von Bäuerinnen und Bauern, Indigenen, Konsumentinnen und Konsumenten, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen werden jedoch ungenügend konsultiert und können bei der Definition der Ziele oder der Verteilung der finanziellen Mittel nicht mitreden. Im Führungsrat (Leadership Council) der New Alliance sind neben den Regierungen der G8-Staaten und den Konzernen auch zivilgesellschaftliche Organisationen vertreten, allerdings nur kommerziell orientierte Grossbauern; kritische Organisationen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie unabhängige Nichtregierungsorganisationen fehlen. Wichtige Projekte, die grosse Flächen und viele Menschen betreffen, werden manchmal sogar im Geheimen ausgehandelt (siehe The Guardian, 18.2.2014a und The Guardian, 18.2.2014b).
Während die New Alliance durch ihre Zusammenarbeit mit den Regierungen afrikanischer Länder einen gewissen Grad an demokratischer Legitimität mitbringt, fehlt diese den privaten Stiftungen vollständig. Ihre Strategien und Programme sind einzig dem Willen des Stifters oder der Stifterin verpflichtet und beeinflussen – durch die schiere Menge ihres Geldes – die Landwirtschaftspolitik von Ländern ausserhalb jeglicher demokratischer Strukturen.
Private Stiftungen: Wohltätigkeit der Superelite
Die grösste Stiftung der Welt ist die Bill and Melinda Gates Foundation. Im Vergleich mit diesem Koloss erscheint die Syngenta-Stiftung als Zwerg. Die Gates Foundation steckt riesige Geldbeträge in die von ihr definierte Form der Entwicklung der afrikanischen Landwirtschaft und hat in Zusammenarbeit mit der Rockefeller Foundation die „Alliance for a Green Revolution in Africa“ (AGRA) ins Leben gerufen. Diese wird mittlerweile auch von einzelnen staatlichen Stellen (aus Australien und England) und grossen internationalen Organisationen mitfinanziert (siehe GRAIN, 4.11.2014). AGRA wünscht sich eine „einzigartige afrikanische Grüne Revolution“ (siehe Website von AGRA). Viele Stimmen aus der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft sprechen sich jedoch klar gegen diese scheinbare Revolution mit ihrem Fokus auf industriell-kapitalistische Landwirtschaft aus.
Mit Kofi Annan konnte zu Beginn mit einem klugen Schachzug ein ehemaliger UN-Generalsekretär als Vorsitzender der Stiftung gewonnen werden, denn AGRA möchte nach eigenen Angaben eine „echt afrikanische“ Organisation sein, die „ihre Basis in Afrika hat und von Afrikanerinnen und Afrikanern geleitet wird“ (siehe Website von AGRA). Doch es gibt vielfältigen und lauten Widerstand – ebenfalls von Afrikanerinnen und Afrikanern. Verschiedene Mitglieder des Bündnisses für Ernährungssouveränität in Afrika (AFSA) äussern sich sogar besorgt darüber, dass die Gates Foundation mittlerweile eine Bedrohung für ihre Arbeit geworden sei. Sobald eine Gruppe oder NGO Erfolg habe, würde sie von der Gates Foundation finanzielle Unterstützung erhalten und in der Folge ihre politischen Anliegen nach und nach aufgeben. Dass die Zivilgesellschaft bei wichtigen Entscheidungen nicht eingebunden wird, zeigt auch ein Geheimtreffen, das von der die Gates Foundation zusammen mit USAID (United States Agency for International Development) 2015 in London organisierte wurde, um in Afrika die Privatisierung von Saatgut- und Agrarmärkten voranzutreiben – einmal mehr, ohne Organisationen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern oder sonst betroffene Menschen einzuladen (siehe Food First, 23.3.2015).
AGRA ist besonders eng mit Monsanto verknüpft. Aber auch Syngenta ist bei vielen von AGRAs Projekten dabei. Ein Bericht des „Afrikanischen Zentrums für Biodiversität“ in Südafrika über AGRA kommt zu folgendem Schluss: „Monsanto, DuPont, Syngenta und andere Saatgut- und Agrochemiemultis sowie Aktienfonds stehen hinter der AGRA-Show schon bereit. Es werden neue Märkte für kommerzielles Saatgut in Afrika geschaffen und eine Infrastruktur dafür gebaut. Das öffnet die Türen für eine zukünftige Übernahme durch multinationale Unternehmen“ (siehe African Centre for Biosafety, 2012).
Saatgutmärkte: geistiges Eigentum schützen
Mit Monsanto, DuPont Pioneer und Syngenta sind die drei grössten Saatgutkonzerne der Welt in der New Alliance vertreten. Bei dieser hat der Saatgutsektor oberste Priorität – sowohl bei den Investitionsversprechen der multinationalen Konzerne als auch bei den politischen Verpflichtungen der zehn involvierten afrikanischen Länder (siehe Oxfam, 19.11.2014). Die Änderungen der politisch-ökonomischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen zielen vor allem darauf ab, mit neuen Sortenschutzgesetzen für Pflanzenzüchtungen geistige Eigentumsrechte zu schützen, private Investitionen im Saatgutsektor zu fördern und sogenannte ‚verbesserte’ Sorten zu vermarkten.
Als ‚verbesserte’ Sorten bezeichnen die Konzerne kommerzielle Hybrid- oder Gentechniksorten. Weil diese Sorten ihr Potenzial nur in Kombination mit Pestiziden und chemischem Dünger entfalten, können multinationale Unternehmen nicht nur ihren Saatgut-, sondern auch ihren Pestizidverkauf steigern. Für Syngenta stellt dies ein sehr lukratives Geschäft dar. So betont die Syngenta-Stiftung, wie wichtig es sei, ein förderliches Umfeld („enabling environment“) zu schaffen, welches dem privaten Saatgutsektor Investitionen ermöglicht. In Kenia und Tansania will die Syngenta-Stiftung beispielsweise bis im Jahr 2016 250‘000 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern mit kommerziellem Saatgut versorgen (siehe Website von Syngenta Foundation).
Was der schöne Begriff „enabling environment“ für die Allianzen konkret bedeutet, sieht man in denjenigen Ländern, in denen die Umgestaltung der Saatgutgesetze schon weit fortgeschritten ist. Die New Alliance selbst sagt, dass dieser Prozess schnell gehe und die Reformen im Saatgutsektor einer ihrer „bemerkenswerten Erfolge in der Reform von gesetzlichen Rahmenbedingungen“ seien (siehe Oxfam, 19.11.2014). Unter dem Vorwand, Forschung und Innovation für das Wohl aller zu fördern, hat es der industrielle Saatgutsektor geschafft, immer weitreichendere geistige Eigentumsrechte auf Saatgut zu erhalten. Die neuen Sortenschutzgesetze, basierend auf dem internationalen Sortenschutzabkommen UPOV 91 (International Union for the Protection of New Varieties of Plants, 1991 Act), schützen die Interessen und Rechte von Züchterinnen und Züchtern, also Saatgutfirmen und Forschungsinstitutionen. Konkret heisst das, dass nur sie Monopolrechte an den von ihnen entwickelten Sorten haben. Das Recht der Bäuerinnen und Bauern, das Saatgut ihrer Ernte im nächsten Jahr wieder zu nutzen, zu tauschen oder zu verkaufen, wird hingegen drastisch eingeschränkt. Die Bäuerinnen und Bauern können ihrerseits ihre lokalen Sorten meist nicht schützen, da sie die globalen Standards für kommerzielles Saatgut nicht erfüllen (siehe Oxfam, 19.11.2014). Da aber nur zertifiziertes Saatgut verkauft werden darf, wird es für die Bäuerinnen und Bauern illegal, sich gegenseitig ihr eigenes Saatgut zu verkaufen. Diese Kriminalisierung betrifft sehr viele von ihnen, da in Afrika 80 Prozent des Saatguts durch informelle Netzwerke produziert und verbreitet wird. Aus Kenia, wo die Reform der Sortenschutzgesetze schon weit fortgeschritten ist, berichtet Daniel Maingi von der NGO Growth Partners Africa, einer Partnerorganisation von Brot für alle, dass sich Bäuerinnen und Bauern strafbar machen, wenn sie ihr lokales Saatgut weiterverkaufen, ohne als Händler oder Händlerinnen registriert zu sein. Es drohen ihnen bis zu zwei Jahren Haft oder eine Busse von umgerechnet fast 50‘000 Franken. Bei einem Einkommen von durchschnittlich 1300 Franken im Jahr liegt ein absurder maximaler Strafbetrag vor.
Die neuen Saatgutgesetze verschaffen den Agrokonzernen einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten vor Ort, also den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie den lokalen Züchterinnen und Züchtern. Auch die grösseren lokalen Konkurrenten im Markt werden eliminiert. So hat Syngenta 2013 zum Beispiel den sambischen Saatgutproduzenten MRI Seeds übernommen, dessen Sammlung von Maiskeimgewebe zu den vollständigsten und vielfältigsten in ganz Afrika zählte. Syngenta selbst sieht diesen Kauf als „Ausdruck unseres Engagements für eine nachhaltige Entwicklung in Afrika – dem Kontinent, der zweifellos das grösste Wachstumspotenzial aufweist. Kleinbauern und grössere Betriebe in Sambia werden sehr bald von der kombinierten Innovationskraft von MRI und Syngenta in den Bereichen Saatgut, Seed Care und Pflanzenschutz profitieren“ (siehe Syngenta, 3.7.2013). Die Konzentration des Saatgutgeschäfts bei den grossen Agrochemiekonzernen birgt die Gefahr, dass nur noch Sorten entwickelt werden, die auf eine industrialisierte und chemieintensive Landwirtschaft zugeschnitten sind. So konzentrieren sich die drei Riesen Monsanto, DuPont und Syngenta oft nur auf die zwei, drei profitabelsten Arten. Durch gezielte Übernahmen von lokalen Firmen haben sie sich eine dominante Position im Mais- und Baumwollmarkt gesichert. Diese zwei Arten eignen sich besonders gut für den Einsatz von Gentechnologie (siehe Food First, 10.9.2014).
Den Weg für die Gentechnik ebnen
Das Afrikanische Zentrum für Biodiversität hat die Auswirkungen dieser von Konzernen vorangetriebenen ‚Entwicklungsprogrammen’ in der afrikanischen Landwirtschaft erforscht und ist zum Schluss gekommen, dass diese unter anderem dazu dienen, Afrika für genveränderte Organismen (GVOs) zu öffnen. Und dies durchaus erfolgreich, wie von den Konzerne selbst stolz verkündet wird. So sind einige Mitgliedstaaten der New Alliance wie Nigeria bereits dabei, Gentechsaatgut zuzulassen (siehe Oxfam, 19.11.2014).
Ein Beispiel für die Bestrebungen der Konzerne und ihrer Verbündeten, GVOs zu verbreiten, ist das Projekt „Insektenresistenter Mais für Afrika“ (IRMA). Es wurde zu einem gewichtigen Teil 1999 in Kenia in Zusammenarbeit mit der Regierung durchgeführt. Finanziert wurde es hauptsächlich von der Novartis-Stiftung (heute Syngenta-Stiftung), aber auch von verschiedenen Regierungsbehörden und Universitäten, der Rockefeller Foundation sowie Monsanto. Das Ziel war, mittels gentechnischer und konventioneller Züchtung Hybridsaatgut herzustellen (Kreuzungen mit transgenem Bt-Mais), das gegen den Stängelbohrer, einen Maisschädling, resistent ist. Das Afrikanische Zentrum für Biodiversität attestierte dem Projekt zumindest das hehre Ziel, die Bt-Technologie für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern kostenlos zugänglich zu machen. Doch das Projekt scheiterte aus den folgenden drei Gründen.
Erstens zeigte die Forschung klar, dass es unmöglich ist, GVOs in kleinbäuerliche Systeme einzubringen, ohne die aktuellen landwirtschaftlichen Praktiken zu untergraben. Grund dafür ist, dass die Bt-Technologie für unkontrollierte Bestäubung und Nachbau (Saatgutgewinnung auf dem eigenen Betrieb) schlicht nicht geeignet ist (siehe African Centre vor Biosafety, 2013). Also muss das Saatgut jährlich neu gekauft werden, was ein grosses finanzielles Risiko darstellen kann und die Bäuerinnen und Bauern von den Saatgutkonzernen abhängig macht. Zweitens stellte sich 2005 heraus, dass es auf den für IRMA genutzten Genen und genetischen Eigenschaften geistige Eigentumsrechte gibt, zwar nicht für die Forschung, aber für den Anbau. Trotz sofortiger Verhandlungen blieben die Patente in privaten Händen. Drittens ist es dem Projekt nicht gelungen, Resistenzen gegen jene Stängelbohrerart zu entwickeln, die in Kenia mit Abstand die meisten Schäden anrichtet. Selbst wenn dies gelungen wäre, würde die Resistenz vermutlich nur für kurze Zeit wirksam bleiben. Denn der Stängelbohrer erweist sich als sehr anpassungsfähig.
IRMA versuchte die Situation zu retten und verhandelte mit Monsanto darüber, deren Bt-Mais verwenden zu dürfen – ohne Erfolg. Am Projekt IRMA zeigt sich, was auch für viele andere Beispiele gilt: Schlussendlich profitiert nur, wer die Technologie entwickelt hat und die Patente darauf besitzt; meistens sind dies die grossen Agrarkonzerne. Monsanto konnte mehrfach Hilfsprojekte dazu benutzen, die firmeneigenen Produkte auf den Markt zu bringen, Biosicherheitsgesetzgebungen zu unterhöhlen, Zugang zu öffentlichem Keimgewebe zu erhalten und dieses in ihrer eigenen Forschung zu verwenden. Die Sorten, die daraus entwickelt werden, gehören dem Konzern. Auf allfällige Gensequenzen für Resistenzen können zudem Patente angemeldet werden.
IRMA hat sich schlussendlich damit begnügt, konventionelle Maissorten mit Resistenzen gegen verschiedene Insekten zu entwickeln und zu verbreiten. Denn im Gegensatz zur Gentechforschung schaffen es konventionelle Züchtungsprogramme immer wieder, neue Sorten zu entwickeln, die unter den afrikanischen Bedingungen und auf kleinbäuerlichen Höfen gut wachsen. Dies ist billiger und schneller, vor allem aber funktioniert es ohne Patente. Obwohl IRMA die Bt-Technologie in Kenia nicht einführen konnte, erreichte das Projekt, dass die Forschungskapazitäten, das Wissen und die Infrastruktur für Gentechnologie in Kenia stark vergrössert wurden. So ebnen Projekte wie IRMA den grossen Unternehmen den Weg für die Einführung von GVOs in Afrika (siehe African Centre for Biodiversity, 2015).
Weder Angst vor dem Ungewissen noch vor Konzernen und Stiftungen
Die wissenschaftlich fundierte Kritik an Gentechnik interessiert die grossen Geldgeberinnen und -geber wenig. Die riesige „Bill and Melinda Gates Foundation“ zum Beispiel hat eine klare Meinung dazu. In ihrem Bericht bezeichnet sie den Widerstand der afrikanischen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern gegen GVO als „Farce“ und reduziert die Diskussion auf die „Angst vor dem Ungewissen“. Der Bericht endet mit der Versicherung, dass viele Länder (zum Beispiel Kenia, Nigeria oder Kamerun) kurz davor seien, GVOs einzuführen – nicht zuletzt dank unermüdlichem Lobbying der Konzerne (siehe Oxfam, 19.11.2014).
Das neuste Beispiel eines Projektes, das mit einem Entwicklungsversprechen Gentechnik einführen will, ist „Water Efficient Maize for Africa“ (WEMA). Hierbei handelt es sich um eine Kooperation der Gates Foundation und der USAID mit Monsanto und verschiedenen Forschungsinstitutionen. WEMA will mit Methoden der Gentechnik und der konventionellen Zucht trockenheitsresistente Maissorten für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Afrika südlich der Sahara entwickeln. Das Projekt wird von zivilgesellschaftlichen Organisationen stark kritisiert. Einerseits ist Trockenheitstoleranz von Pflanzen ein extrem komplexes Phänomen, und Gentechmais zeigt diesbezüglich nach neusten Erkenntnissen nur sehr minimale Erfolge. Trotzdem propagiert die „Global Alliance for Climate Smart Agriculture“ (GACSA) WEMA als Pilotprojekt für eine landwirtschaftliche Methode, die dem Klimawandel angepasst sei. Die GACSA setzt sich für ein Sammelsurium solcher Methoden ein, die einerseits den Klimawandel eindämmen, andererseits den Bäuerinnen und Bauern eine bessere Anpassung an neue klimatische Verhältnisse ermöglichen sollen. Der heutige drastische Klimawandel beinhaltet katastrophische Szenarien, und die Landwirtschaft – vor allem die industriell-kapitalistische – ist für einen grossen Teil der Treibhausgase verantwortlich. Mithilfe der GACSA versuchen die Agrarkonzerne erneut, ihre Technologien als Lösung für eine Krise zu präsentieren, welche sie selbst mitverursacht haben. In der Hoffnung, ihren Geschäftsmodellen ein grünes Mäntelchen umzuhängen, treiben die grössten Agrobusinesskonzerne, darunter auch Syngenta, die GACSA höchst aktiv voran – wenn auch inoffiziell.
Hungerbekämpfung als falsches Alibi für Konzerninteressen
Die Bekämpfung von Hunger ist ein zentrales Legitimationsargument für diese Programme. Bei genauerer Betrachtung zeigt es sich jedoch, dass Hunger für die Konzerne nur ein weiteres Geschäft ermöglicht.
In Afrika südlich der Sahara hat der Hunger in den letzten Jahren in absoluten Zahlen zugenommen und ist eine tägliche Katastrophe. Die New Alliance propagiert dessen ungeachtet weiterhin, dass Ernährungssicherheit nur durch private Investitionen in die Landwirtschaft erreicht werden kann. Bisher gibt es jedoch keinerlei Beweise dafür, dass diese Armut oder Mangelernährung verringern. Sogar die Weltbank erklärte, dass steigende “Nahrungsmittelproduktion zwar die Verfügbarkeit von Nahrung erhöht, aber für sich alleine wenig tut, um sicherzustellen, dass die armen Menschen Zugang haben zu dem Essen, das produziert wurde“ (siehe Weltbank, 2007). Über Verteilungsgerechtigkeit, welche für die Umsetzung des Menschenrechts auf Nahrung unumgänglich ist, wird konsequent geschwiegen.
Obwohl Menschen in vielen Mitgliedsländern der New Alliance in hohem Masse an Hunger und Mangelernährung leiden, spielt die Ernährungssicherheit für die New Alliance und die beteiligten Regierungen nur in der Rhetorik eine wichtige Rolle. In den tatsächlichen Kooperationsverträgen und den konkreten Programmen kommen Bemühungen für eine ausgewogene Ernährung der Menschen kaum vor. Die privaten Investitionen konzentrieren sich auf Agrargüter, die für den Export angebaut werden, und auf Feldfrüchte, die zwar den Magen füllen, aber keine ausgewogene Ernährung sicherstellen. Auch der Zugang der Menschen zu Nahrung wird nicht diskutiert. Gerade einmal drei Prozent aller Investitionen der New Alliance betreffen Produkte, die für eine ausgewogene Ernährung wichtig und gleichzeitig für den lokalen Markt bestimmt sind (siehe How much is the New Alliance doing for food security and nutrition? Institute of Development Studies, 12.6.2013). Oder anders gesagt: Von 211 Investitionsprojekten der New Alliance verbessern nur 27 die Ernährungssituation der Menschen (siehe The Guardian, 18.2.2014). Mögliche – um nicht zu sagen wahrscheinliche – negative Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit der Bevölkerungen der anderen 184 Investitionen werden in diesen Initiativen nicht behandelt.
Investitionen der New Alliance mit dem Argument, die Ernährungssituation zu verbessern, finden sich in jenen Marktsegmenten, in denen sich die Konzerne Profite erhoffen. Bekannt dafür ist das „Golden Rice“-Projekt, an dem Syngenta massgeblich beteiligt ist (siehe Schwarzbuch Syngenta Kapitel Golden Rice: Agrokonzerne privatisieren Reis). Ein ähnliches Projekt der Syngenta-Stiftung in Afrika betrifft Grundnahrungsmittel, die durch konventionelle Zucht mit Eisen, Zink oder Provitamin A angereichert werden sollen, um die Mangelernährung der Bevölkerungen zu lindern. Ursprünglich war dies ein Projekt des Internationalen Konsortiums öffentlicher Agrarforschungsinstitute (CGIAR), welchem Syngenta seit 2009 angehört (wie auch die Gates Foundation, USAID, die Weltbank u.a.m.).
Die Idee, Hunger zu bekämpfen, indem die Hungernden Grundnahrungsmittel essen sollen, welche von grossen Unternehmen mit Nährstoffen angereichert wurden, ist entlarvend. Menschen müssen sich ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend ernähren können und benötigen eine Auswahl an für sie zugänglichen Nahrungsmitteln, um eine gesunde Ernährung sicherzustellen. Dies ist auch im Menschenrecht auf Nahrung, im Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte so verankert. Konzerne, die den Menschen die profitabelsten Nahrungsmittel verkaufen, können dieses Recht nicht gewährleisten. Dafür braucht es eine wirkliche Ernährungssouveränität.
Lauter Widerstand gegen eine konzernbestimmte Landwirtschaft
Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen soll. Eine mächtige Allianz der Eliten von Nord und Süd, von Wirtschaft, Regierungen und privaten Stiftungen – Syngenta vorne mit dabei – fördert eine Landwirtschaft, die möglichst viel Profit erwirtschaftet und von den grossen Agrarkonzernen beherrscht wird. Aber der Widerstand gegen Allianzen wie die New Alliance und ihre Verbündeten wird immer lauter.
Viele Organisationen von Bäuerinnen und Bauern, von kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Aktivistinnen und Aktivisten wehren sich gegen diese Entwicklungen und zeigen die negativen Seiten auf. Auch in der Schweiz gibt es zahlreiche Stimmen dagegen, darunter Brot für alle. Sie alle setzen sich für einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft ein. Anstehend ist damit ein Ernährungssystem, das von den Menschen bestimmt wird, die darin arbeiten und davon in Würde leben können; dabei kann genug gesundes und schmackhaftes Essen für alle produziert werden, ohne dabei die Umwelt zu zerstören. Sie kämpfen gegen eine Landwirtschaft der Konzerne – und für eine selbstbestimmte, ökologische Landwirtschaft.
Artikel wurde abgedruckt im Schwarzbuch Syngenta und stammt von Silva Lieberherr, Brot für alle/MultiWatch


