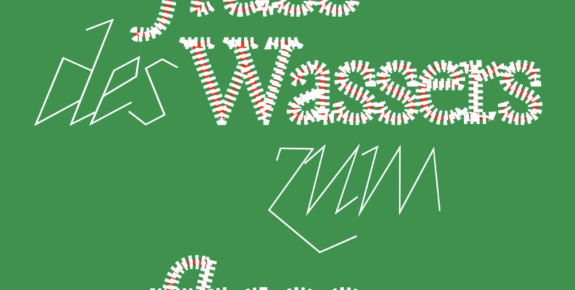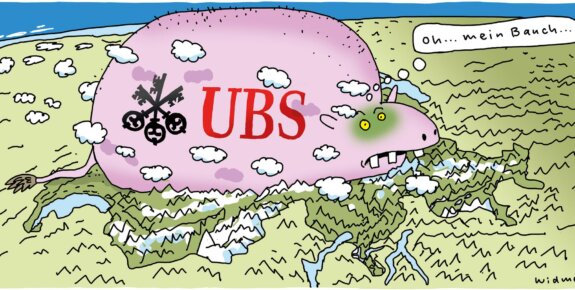7200 Milliarden Franken werden in der Schweiz verwaltet. Ein guter Teil davon wird in klimaschädliche Geschäfte investiert – mit Folgen für die Klimaerwärmung. Schweizer Geld ist also alles andere als grün angelegt. Das soll sich ändern. Auch der Finanzplatz soll einen Beitrag leisten, finden neu auch Bürgerliche.
Artikel von der Basellandschaftlichen Zeitung (2.4.2019)
Die Schweiz ist das Land des Geldes. 7200 Milliarden Franken wurden hier Ende 2017 verwaltet. Banken, Versicherer, Pensionskassen: Sie alle suchen nach Anlagen, die schöne Renditen versprechen. Ans Klima denken sie dabei selten. Das zeigt eine Studie des Bundes. Diese analysiert die Investitionen von Pensionskassen und Versicherungen. Und kommt zum Schluss, dass sie alles andere als klimaverträglich sind. Der Grund: Ein guter Teil des Gel- des fliesst in Firmen, die klimaschädliche Geschäfte betreiben, etwa Erdöl fördern oder Autos bauen.
Investitionen in CO2-arme Alternativen, erneuerbare Energien etwa, sind dagegen laut der Studie Mangelware. Sie rechnet vor, welche Folgen die Investitionslogik des Finanzplatzes für das Klima hat: Sie unterstützen eine Erderwärmung von 4 bis 6 Grad. Also viel mehr als im Pariser Klimaabkommen vorgesehen. Dieses strebt eine Begrenzung auf 1,5 Grad an.
Sommaruga anders als Leuthard
Im Bundeshaus wird derzeit über das CO2-Gesetz debattiert. Es soll die Schweizer Klimapolitik für die Zukunft rüsten. Der Bundesrat anerkennt darin zwar, dass das Investitionsverhalten der Schweiz noch zu wenig klimaverträglich ist. Doch er will weiterhin nicht auf zusätzliche Regeln setzen, wie das andere Länder machen. Sondern auf Freiwilligkeit.
Den Linken ist das schon länger ein Dorn im Auge. So schimpfte etwa SP-Vizepräsident Beat Jans (BS) bei der Debatte über das CO2-Gesetz im Nationalrat, Banken, Pensionskassen und Versicherer seien «die grössten Klimaheizer unseres Landes». Tatsächlich beträgt der CO2-Ausstoss des Finanzplatzes ein Vielfaches dessen, was das ganze Land jährlich ausstösst.
Allmählich gewinnt das Thema nun auch in bürgerlichen Kreisen an Gewicht. Das zeigt sich etwa am Entscheid der Ständeratskommission, die Ziele des Pariser Abkommens explizit im nationalen Recht zu verankern. Dazu gehört auch die Bestimmung, die Finanzmittelflüsse klimaverträglicher zu gestalten. Der Nationalrat hatte auf diesen Schritt noch verzichtet.
In der Ständeratskommission, die sich in diesen Tagen zum zweiten Mal mit dem CO2-Gesetz befasst, sieht das anders aus. Zudem sind dort auch Berichte zum Thema emissionsarme Finanzflüsse bestellt worden. Das stösst bei der neuen Umweltministerin, Simonetta Sommaruga, auf Anklang. Anfang März sagte sie im Interview mit der «NZZ am Sonntag», sie unterstütze die Absicht, auch den Finanzplatz ins CO2-Gesetz einzubeziehen, sehr.
Bürgerliche Einsicht
Wie handfest das alles wird, ist derzeit schwer abzuschätzen. CVP-Ständerat Beat Vonlanthen will sich wegen der laufenden Beratung noch nicht detailliert zum Thema äussern, sagt aber, dass es Handlungsbedarf gebe. «Man darf diese Thematik nicht ausklammern», so der Freiburger. Auch andere bürgerliche Ständeräte, etwa der Luzerner Damian Müller (FDP), haben sich in diese Richtung geäussert. Ein anderer Beleg für die neue Dynamik ist ein Vorstoss, den SP-Nationalrat Cédric Wermuth in der Frühlingssession eingereicht hat. Er verlangt, dass Banken ihre Kunden auf deren Wunsch hin über die Klimabilanz ihrer Anlagen informieren müssen. Der Vorstoss wurde von Politikern aus BDP, CVP und GLP unterschrieben.
Schweiz im Hintertreffen
Michael Taschner von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma PwC begrüsst, dass die Dinge auch hierzulande in Bewegung geraten. Der Experte für Aufsichtsrecht und Nachhaltigkeit warnt davor, dass die Schweiz «ins Hintertreffen» gerate, wenn ihr Finanzplatz nicht klimaverträglicher wird. PwC hat gemeinsam mit dem WWF eine Studie veröffentlicht, die unter anderem anregt, dass der Bundesrat einen Aktionsplan zum Thema nachhaltige Investitionen erlässt – so, wie das die EU bereits getan hat. Dieser sieht etwa vor, dass nachhaltige von nichtnachhaltigen Finanzprodukten unterschieden werden müssen. Auch sollen Investoren nachweisen, inwieweit ihre Investitionen an Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet sind. Dieser EU-Aktionsplan, sagt Taschner, zwinge auch die Schweiz zum Handeln. «Ohne Vorgaben zu Transparenz und Nachhaltigkeit könnte der Zugang zum EU-Markt für Schweizer Finanzunternehmen auf dem Spiel stehen», sagt er – und betont, eine zügige Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit biete auch «gewaltige Chancen».